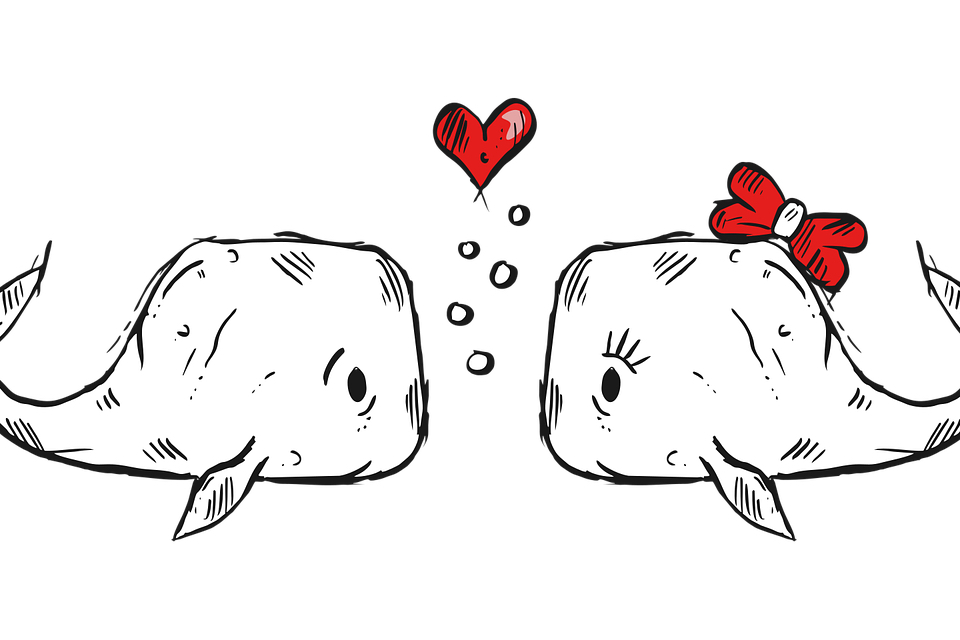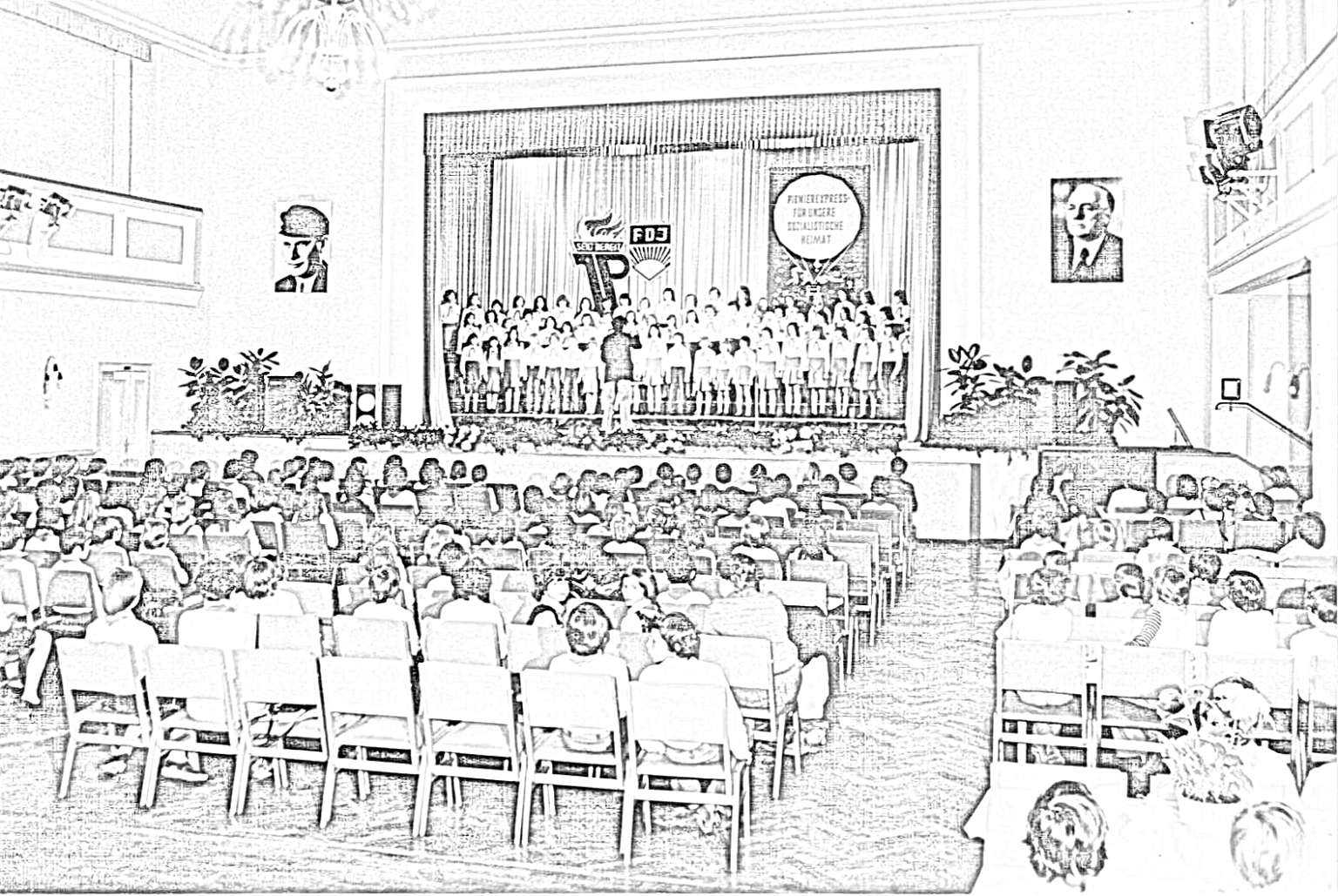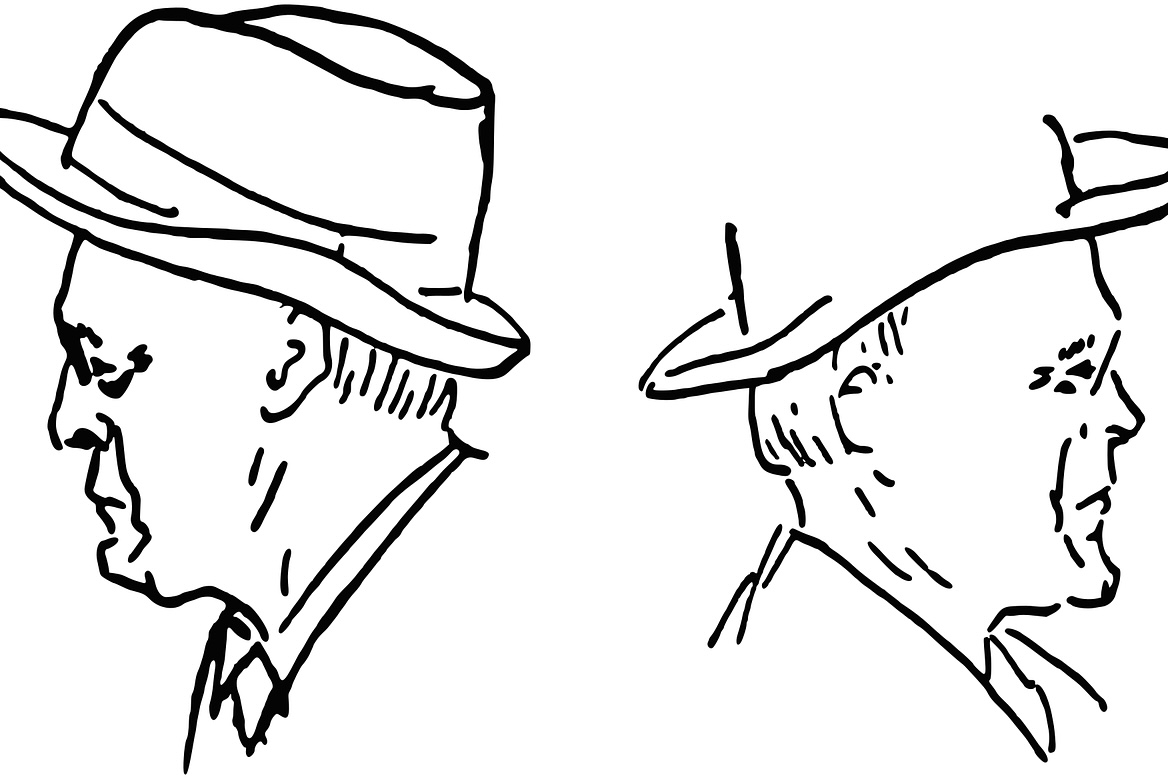Kontaktabbruch in der Familie: Wenn Kinder sich abwenden
Ein Kontaktabbruch in der Familie kommt häufiger vor, als wir denken. Eine solche Entscheidung ist eine Zäsur, die mit Leid verbunden ist. Bei Eltern und Kindern. Oftmals gibt es Gründe, aus denen es den Betroffenen unmöglich erscheint, die familiäre Beziehung weiterzuführen. Doch haben immer nur die Eltern Schuld? Gibt es überhaupt eine Schuldfrage? Und was kannst du tun, wenn du in einer solchen Situation steckst? Gibt es einen Moment, in dem du die Entscheidung akzeptieren und nicht mehr kämpfen solltest? Eine Suche nach Antworten zu einem schwierigen Thema.

Wenn die Eltern-Kind-Beziehung kompliziert ist
Harmonie in einer Familie ist kein Selbstläufer. Unter vielen Dächern gibt es Sorgen, Probleme und Auseinandersetzungen. Nicht alle schaffen es, dauerhaft ein gutes Verhältnis zueinander zu pflegen. Und so einfach ist das auch nicht: Da gibt es ein Paar, das sich ineinander verliebt. Beide stammen aus unterschiedlichen Elternhäusern. Die Frau hat andere Werte vermittelt bekommen als der Mann. Schwiegereltern fremdeln mit dem neuen Familienmitglied. Schwiegerkinder fühlen sich in der Familie des Partners nicht wohl.
Fremde Menschen gehören plötzlich zu einer Familie
Durch die Heirat der Kinder kommen ganz unterschiedliche Charaktere zusammen. Dies gilt natürlich auch für Lebenspartnerschaften. Wenn sich die Kinder ineinander verliebt haben, heißt das noch lange nicht, dass diese tiefe Zuneigung auch auf die Schwiegereltern überschwappt. Umgekehrt gibt es Eltern, die mit der Partnerwahl des Nachwuchses so gar nichts anfangen können.
Viele Familien schaffen es, sich mit ihren Stärken und Schwächen zu akzeptieren. Sind die Lebensentwürfe so unterschiedlich, dass sich Schwiegereltern und Schwiegerkinder bei einem zufälligen Kennenlernen sofort aus dem Weg gehen würden, gibt es immer noch den kleinsten gemeinsamen Nenner. Wir gehören nun zu einer Familie und machen das Beste draus. Doch leider funktioniert das nicht immer.
Kinder ziehen häufiger den Schlussstrich
Ein Kontaktabbruch in der Familie kann durch Eltern und Kinder ausgelöst werden. Häufiger sind es die Kinder, die sich von den Eltern abwenden. Einige treffen die Entscheidung, bevor sie eine Partnerschaft eingegangen sind. Traumatische Erlebnisse in der Kindheit sind ein Grund. Aber auch mangelndes Verständnis für den Lebensweg von Mutter oder Vater.
Weitere Ursachen liegen in ständiger Bevormundung. Überbordender Kritik. Antipathie. In übermäßiger Fürsorge der Eltern. In der fehlenden Fähigkeit, loszulassen. Oder die Lebensentwürfe sind so unterschiedlich, dass ein Miteinander nicht möglich erscheint.
Es kommt auch vor, dass Eltern keinen Kontakt zu ihren Kindern möchten. Diese Variante des Kontaktabbruchs in der Familie wird seltener thematisiert. Mutter oder Vater können den Charakter oder das Verhalten des Kindes nicht mehr billigen oder nicht damit umgehen. Aber auch Straftaten, Gewalt oder die Berufswahl sind Gründe für diese Entscheidung.
Es gibt keine Statistiken
Statistiken, Studien oder Forschungsansätze über die Häufigkeit und die Gründe eines Kontaktabbruchs in der Familie gibt es bislang nicht. Die Psychoanalytikerin Dr. Dunja Voss schätzt die Zahl der Familien, die von einem Kontaktabbruch betroffen sind, auf etwa 100.000 ein.
Die Dunkelziffer ist hoch, denn in vielen Familien wird über einen Kontaktabbruch des Kindes nicht gesprochen. Wenn Freunde, Bekannte oder Arbeitskollegen fragen, sind die Antworten ausweichend. Oder es wird zur Lüge gegriffen.
Kontaktabbruch in der Familie – die Frage nach dem „Warum“
Familien, die von einem Kontaktabbruch betroffen sind, fragen nach dem Grund. Häufig erfahren sie ihn nicht. Oder es kommt nach vielen Jahren heraus, dass keiner benannt werden kann. Dr. Dunja Voss sucht die Ursachen in der Kindheit und Jugend der Betroffenen, die sich für einen Kontaktabbruch entscheiden.
Wenn man die Eltern fragt, dann wissen sie nicht, warum ihre Kinder sie verlassen haben. Aber wenn man die Kinderseite hört, dann ist meist sehr viel vorgefallen.
Psychoanalytikerin Dr. Dunja Voss. Quelle: „Wie es sich für Eltern anfühlt, wenn ihre Kinder den Kontakt abbrechen“. Die Zeit vom 26. Dezember 2016
Zwischenmenschliche Beziehungen sind komplex und sehr individuell. Die meisten Eltern wollen für ihre Kinder das Beste. Doch auch dann können sie Fehler machen. Erwachsene Kinder reflektieren ihre Kindheit anhand der Erlebnisse, aber auch aufgrund der Hürden, die sie meistern müssen. Dringen traumatische Ereignisse hervor, scheint ein Kontaktabbruch das einzige Mittel zu sein. Doch der Grund wird nicht kommuniziert. Nicht selten sehen sich die Eltern von einem Tag zum anderen vor eine Entscheidung gestellt, den sie nicht einmal hinterfragen können.
Die Partnerwahl kann den Kontakt beeinflussen
Frau Dr. Voss beschäftigt sich in ihrem Artikel ausschließlich mit Kindern, die sich ohne Einflussnahme eines Partners für den Kontaktabbruch entschieden haben. Es kommt aber häufig vor, dass der Kontaktabbruch erst nach der Bindung an einen Partner vollzogen wird. Für die Eltern stellt es sich so dar, als hätte das Schwiegerkind den Kontaktabbruch beeinflusst. In einigen Fällen ist das wirklich so. In anderen bekommt das Kind durch die Partnerschaft einen neuen kritischen Blick auf das eigene Elternhaus.
Die böse Schwiegermutter, die sich überall einmischt und vornehmlich den Sohn nicht loslassen möchte, ist keine Erfindung der Traumfabrik in Hollywood. Es gibt sie wirklich. Genauso wie es Schwiegertöchter gibt, die den Sohn seiner Herkunftsfamilie entziehen.
Schwiegermutter gegen Schwiegertochter (und umgekehrt)
In alten Weisheiten ist zu lesen, dass Töchter den Schwiegersohn in ihre Familie hinüberziehen. Die Eltern des Sohnes bleiben zurück. Tatsächlich ist es so, dass Konflikte eher zwischen Schwiegertöchtern und Schwiegermüttern ausbrechen. Schwiegersöhne und Schwiegermütter sind seltener von einem Konflikt belastet. So betrifft der Kontaktabbruch häufiger die Eltern des Sohnes. Zu den Eltern der Mutter ist das Verhältnis besser.
Auch hier ist die Frage nach dem „Warum“ schwierig zu beantworten. Es gibt Schwiegermütter, die ihren Sohn nicht loslassen möchten. Sie engen ihn ein. Die Schwiegertochter kann nichts recht machen. Sie kocht nicht gut, die Haushaltsführung ist schlecht, die Frisur könnte mal wieder geändert werden.
Schwiegertöchter können Neid auf eine besonders enge Bindung zwischen Mutter und Sohn entwickeln. Sie reagieren mit Ablehnung gegen die Frau, die ihren Sohn geboren hat. In beiden Fällen steht der Sohn zwischen seiner Frau und seiner Mutter. Der Kontaktabbruch scheint ein letzter Ausweg zu sein. Manchmal ist er aber auch Folge einer fehlenden Kommunikation. Oder das junge Paar möchte jeglichen Konfrontationen aus dem Weg gehen.
Töchter kämpfen eher um ein gutes Verhältnis zu Mutter und Vater, während Söhne den Kontaktabbruch hinnehmen. Die Konsequenz ist, dass Eltern eines Sohnes häufiger von einem Kontaktabbruch betroffen sind, als Eltern einer Tochter.
Drei Geschichten aus dem Leben
Vielleicht kennst du Familien, die von einem Kontaktabbruch betroffen sind. Vielleicht hast du dich selbst dafür entschieden oder du bist im Freundes- und Bekanntenkreis mit dem Thema konfrontiert worden. So geht es mir auch. Schon als Teenager habe ich erlebt, dass eine Mutter ihre Tochter ablehnte. Später erlebte die Tochter Gleiches bei ihrer Tochter.
Zwei weitere Beispiele für einen Kontaktabbruch in der Familie haben mich dazu bewegt, dieses Thema als Nebenhandlung in meine Romanreihe aufzunehmen. Dort hat die Mutter das Leben ihres Sohnes vor dessen Volljährigkeit bereits verplant. Als er sich verliebt und seine Heimat verlässt, kommt es zu schlimmen Auseinandersetzungen. Die Folge ist ein Kontaktabbruch.
Ein Stiefvater verplant das Leben seines Stiefsohns
In der Realität war der Junge ein Stiefkind, das aus der vorehelichen Affäre der Mutter stammte. Das war in den 1960er-Jahren nicht so normal wie heute. Der Stiefvater heiratete die Frau, ein zweiter ehelicher Sohn wurde geboren. Der Stiefvater verlangte Dankbarkeit von dem Stiefsohn. Schließlich durfte er in seinem Haus aufwachsen.
Der Junge durfte seinen Traumberuf nicht lernen. Stattdessen organisierte der Stiefvater eine Lehrstelle in seinem Betrieb. So behielt er den Jungen im Blick. Er sollte im Ort wohnen bleiben und den Eltern zur Hand gehen. Bei der Gartenarbeit, bei Reparaturen am Auto und Modernisierungen im Haus. Eine Frau war in der Lebensplanung nicht vorgesehen. Und wenn, dann bitte in der Form, dass sie sich der Familie unterordnete und zuließ, dass die Schwiegermutter die Haushaltsführung bestimmte und regelmäßig „nach dem Rechten“ sah.
Nach dem Abschluss seiner Lehre lernte der Junge ein Mädchen kennen, das 200 Kilometer entfernt wohnte. Er verliebte sich und folgte ihr in ihre Heimat. Die Ablehnung seiner Eltern bekam er von diesem Tag an regelmäßig zu spüren. 30 Jahre kämpfte er um ein gutes Verhältnis zu den Eltern. Doch sie zeigten wenig Interesse. Nicht an seiner Frau und nicht an den Enkelkindern.
Eine Aussprache beendete das Verhältnis. Der Stiefvater warf seinem Stiefsohn vor, von seinem Geld gelebt zu haben. Er hätte den ihm vorbestimmten Weg verlassen. Das konnte der Stiefvater nicht dulden. Die Mutter lehnte einen Kontakt zu ihrem Sohn ohne Beisein des Stiefvaters ab. Der Sohn hatte die Fünfzig überschritten, als er erkannte, dass er mit dem Kennenlernen seiner späteren Frau nie eine Chance auf ein gutes Miteinander mit den Eltern hatte. In seinem Leben gibt es keine Stiefkinder: Mit dem Mädchen, für das er seine Heimat verließ, führt er bis heute eine bodenständige Ehe.
Wie die Mutter, so die Tochter
Ich nenne das Mädchen Petra. Ihr wahrer Name lautet anders. Petras Mutter trennt sich von ihrem leiblichen Vater, als sie zwei Jahre alt war. An ihren Vater hat sie keine Erinnerung. Sie sieht ihn nie wieder. Zwei Jahre später heiratet die Mutter ein zweites Mal. Petra muss den Namen des neuen Mannes tragen. Sie ist einbenannt. Nicht adoptiert.
Mit elf Jahren bekommt Petra einen kleinen Bruder. Die Beziehung innerhalb der Familie verändern sich. Der Junge wird von seinem Vater bevorzugt. Petra entwickelt sich zu einem provokanten Teenager. Die ablehnende Haltung des Stiefvaters ihr gegenüber spitzt sich zu. Er belegt am Morgen das Bad, sodass sie sich nicht die Zähne putzen kann, und stellt sich vor den Kühlschrank. Mit Sechzehn zieht Petra in ein Wohnheim. Der Kontakt zu Mutter und Stiefvater bricht ab.
Petras eigene Familie
Petra heiratet früh. Sie bekommt zwei Kinder. Ihren Mann liebt sie nicht. Sie lernt einen anderen Mann kennen, trennt sich und nimmt die Kinder mit. Immer wieder bemüht sie sich um Kontakt zu ihrer Mutter, doch diese ist für ihre Tochter nicht zu sprechen.
Mit ihrem neuen Partner bekommt Petra ein drittes Kind. Sie heiratet ihn. Als ihre älteste Tochter zwölf Jahre alt ist, reißt sie zu Hause aus. Sie möchte bei ihrem leiblichen Vater wohnen. Das Verhältnis zwischen Vater und Mutter ist schlecht. Der neue Partner hetzt. Petra hat kein Interesse an einem guten Verhältnis zu ihrem Ex-Mann. Sie holt die Tochter mit Hilfe des Jugendamtes zurück.
Wie ihre Mutter, zieht auch die Tochter mit Sechzehn Jahren aus. Mit Achtzehn verlässt sie ihre Heimat und zieht in eine 500 Kilometer entfernte Großstadt. Allein, ohne dort jemanden zu kennen. Sie öffnet sich gegenüber Freunden: Der neue Mann der Mutter hätte sie missbraucht. Da war sie zehn Jahre alt. Petra gibt zu, dass da etwas war. Das Mädchen hat sich das nicht ausgedacht. Doch sie verharmlost die Sache und bleibt mit dem Mann verheiratet.
Eine Anzeige erstattet die Tochter nie. Sie möchte sich mit den Erlebnissen nicht so intensiv auseinandersetzen. In der Folge zieht der leibliche Bruder des Mädchens mit Achtzehn zum Vater. Den Kontakt zur Mutter schränkt er auf ein Minimum ein.
In der zweiten Lebenshälfte ist Petra allein
Das jüngste Kind von Petra weiß nicht, warum die Halbgeschwister die Familie verlassen haben und sich kaum noch melden. Es bekennt sich im Teenageralter zur Homosexualität. Petra lehnt das Outing ab und bezeichnet ihr Kind als asozial. Auch dieses Kind verlässt die Familie. Es behält den Kontakt zu den Eltern. Aber das Verhältnis ist distanziert.
Petra hat Enkelkinder, die sie nur wenige Tage im Jahr sehen darf. Der Schwiegersohn lehnt sie ab: Wenn sie ihre Tochter in ihrer neuen Heimat besucht, muss sie in einer Pension schlafen. Die Tochter besucht ihren leiblichen Vater oft. Ihr Elternhaus, in dem sie mit der Mutter und dem neuen Mann lebte, hat sie nie wieder betreten.
Die Parallelen zu ihrer eigenen Kindheit werden in Petras Lebensgeschichte sehr deutlich: Die Mutter entschied sich für den Ehemann und kehrte sich von der Tochter ab. Petra ging einen Schritt weiter: Sie blieb trotz des Missbrauchs an der Tochter bei ihrem Mann.
Kontaktabbruch quer durch die Familie
Zu ihrer Mutter fand Petra nie wieder Kontakt. Ihre eigenen Kinder sah sie nur selten. In der zweiten Lebenshälfte begann sie sich im sozialen Bereich und in der Gemeinde zu engagieren. Mit ihrem zweiten Mann blieb sie verheiratet. Auch das hat sie mit ihrer Mutter gemein.
Petras jüngerer Bruder brach nach seiner Hochzeit den Kontakt zu seinen Eltern ebenfalls ab. Seine Frau hatte eine andere Nationalität, das passte den Eltern nicht. Petras Mutter und ihr Stiefvater blieben in ihrer letzten Lebensphase allein. Petra und ihr Halbbruder sahen sich nie wieder.
Kontaktabbrüche oder Einschränkungen im Kontakt ziehen sich bei Petra durch zwei Generationen. Was sie in ihrer Jugend erlebte, projizierte sie in einer gesteigerten Form auf ihre Kinder. Der Mann ist im Leben wichtiger als das Kind aus erster Ehe.
Unüberwindbare Missverständnisse
Ein Junge wächst in einer Familie mit Vater, Mutter und Geschwistern auf. Das Verhältnis zu den Eltern ist gut. Mit Anfang 20 lernt er seine spätere Ehefrau kennen. Schon in den ersten Wochen kommt es zu Spannungen zwischen der Mutter und der Freundin. Diese konnte sich mit einigen Gepflogenheiten der Familie nicht anfreunden und übte Kritik. So verstand sie nicht, warum der Sohn von seinem Lehrgeld sein Handy selbst bezahlen musste. Wenige Wochen nach dem Kennenlernen zog der Sohn zur Freundin. Beide heirateten früh und bekamen Kinder.
In den Jahren bis zur Lebensmitte des Paares kam es immer wieder zu Kontaktabbrüchen mit den Eltern des Sohnes. Sie dauerten einige Wochen, dann einige Monate. Es folgten drei Jahre, später sechs. Immer wurden sie von dem jungen Paar ausgelöst.
Nach der Wiederaufnahme des Kontakts, den Sohn und Schwiegertochter suchten, ergaben sich Gespräche. Warum konnte es so weit kommen? Es gab Missverständnisse, die nicht der Rede wert waren. Der Sohn hätte sie leicht aufklären können. Das junge Paar gab zu, dass es keinen wirklichen Grund benennen konnte.
Nach der sechsjährigen Pause gab es einige harmonische Phasen. Die Großeltern konnten eine Beziehung zu den Enkelkindern aufbauen. Doch keine zwei Jahre nach dem Wiedersehen gab es die erste mehrwöchige Pause. Wieder häuften sich die Auszeiten: Sie dauerten drei Monate an, dann lief es für einige Wochen wieder ganz normal, bis sich die junge Familie erneut zurückzog. Mittlerweile waren Sohn und Schwiegertochter in der Mitte ihres Lebens angekommen.
Die Entscheidung der Eltern
Der letzte Kontaktabbruch war von Vorwürfen begleitet, die nicht persönlich, sondern via Kurznachricht vorgetragen wurden. Wieder handelte sich um Missverständnisse. Die Eltern sollten sich für Worte rechtfertigen, die sie gesagt hatten, und für Unternehmungen, die sie ohne die Familie planten. Sohn und Schwiegertochter wollten das nicht tolerieren.
Nach fünfzehn Jahren entschieden sich die Eltern, den Konflikt ruhen zu lassen. Da falsche Worte und ein falscher Blick zu einem Rückzug der gesamten Familie führten, wussten sie nicht, wie sie das Problem lösen sollten. Sie wollten ihre Enkel schützen, die gern mit ihnen zusammen waren, aber dann von einem Tag zum anderen nicht mehr kamen. Und sich selbst, vor einem Verhältnis, das sie zunehmend belastete.
Halt gab den Eltern das gute Verhältnis zu den anderen Kindern, die ihren Bruder nicht verstanden. Die Suche nach einem Grund für das instabile Verhältnis brachte eine konfliktreiche Kindheit der Schwiegertochter zutage. Konnte sie mit dem stabilen Zusammenhalt ihrer Schwiegerfamilie nicht umgehen?
Sind Kontaktabbrüche in der Familie vermeidbar?
Wir Menschen sind einzigartig. Jeder von uns hat eigene Vorstellungen von seinem Leben, vom menschlichen Mitarbeiter und von der Art, wie Familie funktionieren kann. Probleme, Diskussionen, Streit und Missverständnisse sind keine Seltenheit. Wir können sogar sagen: All das ist normal. Wir werden nicht nur in der Eltern-Kind-Beziehung herausgefordert, sondern auch in anderen menschlichen Verbindungen. In der Partnerschaft, im Freundeskreis, unter den Kollegen. Auch in diesen Bereichen gibt es Kontaktabbrüche. Sie können ebenso schmerzhaft sein. Doch sie die Beziehungen sind nicht so eng wie die Verbindung in der Familie. Diese besteht lebenslang.
Wer den Kontakt zu seinen Eltern – oder auch zu seinen Kindern – abbricht, tut dies in aller Regel nicht aus Gleichgültigkeit. Er hat Gründe, die für ihn so schwerwiegend sind, dass er sich eine Fortsetzung des familiären Verhältnisses nicht vorstellen kann. Niemandem steht es zu, darüber zu urteilen.
Vermeidbar sind Kontaktabbrüche nur, wenn es durch intensive Kommunikation, durch Toleranz und ein gewisses Bedürfnis an familiärer Harmonie gelingt, aufkeimende Konflikte zu lösen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Zerwürfnis in der Familie nicht durch Vorkommnisse entstanden ist, die eine tiefe Verletzung zur Folge hatten. Dazu können gehören:
- Missbrauch
- Gewalt
- Emotionale Vernachlässigung
- Konflikte mit Stiefelternteilen
- Trennung der Eltern
Spielt es eine Rolle, ob ein Kind in einer harmonischen oder einer konfliktreichen Familie aufgewachsen ist? Wir wissen, dass die Kindheit unser Leben in einem hohen Maße prägt. Es gibt zwei Typen von Menschen, die als Kind Konflikte erleben mussten: Die einen wünschen sich als Erwachsene Harmonie. Sie möchten das, was sie selbst erleben mussten, anderen nicht antun. Und es gibt diejenigen, die im Erwachsenenalter die Rolle einnehmen, die sie als Kind ertragen mussten. Sie projizieren das Erlebte auf andere und sehen darin eine Verarbeitung ihres eigenen Traumas.
Toleranz, Akzeptanz und Miteinander reden
Ist der Bruch mit den Eltern nicht unüberwindbar, können drei Säulen helfen, einen Kontaktabbruch zu vermeiden. Mit Toleranz, offenen Gesprächen und Akzeptanz für das Leben des anderen kann ein gutes Miteinander gelingen. Gerade, wenn die eigene Familie und die Schwiegerfamilie in ihrer grundlegenden Lebensweise nicht zueinander passen, ist Toleranz ein wahres Zauberwort.
Sollte die Abneigung unüberwindbar sein, hilft vielleicht eine kleine Geschichte aus meiner eigenen Familie: Meine Großmutter mütterlicherseits und mein Vater standen sich menschlich nicht besonders nah. Wenn wir sie besuchten, blieb mein Vater meistens zu Hause. Er kam nur mit, wenn ein familiärer Höhepunkt einen Anlass gab. Das waren die Besuche von Tante und Onkel aus Westdeutschland oder runde Geburtstage.
Wenn meine Mutter mit uns Kindern allein zur Oma fuhr, fiel über meinen Vater kein negatives Wort. Es wurden allgemeine Dinge besprochen. Die Arbeit, die Gesundheit, die Ernte, der letzte Urlaub. War er dabei, begegneten sich Oma und mein Vater mit Respekt und Höflichkeit. Sie besuchte uns nie. Damit drückte sie aus, dass etwas nicht stimmte. Dennoch gelang es mit dieser Strategie, eine gewisse Harmonie in der Familie herzustellen.
Achtung und Respekt vor der Lebensleistung des anderen
Meine Großmutter wurde zur Jahrhundertwende geboren, meine Eltern sind Kinder des Zweiten Weltkriegs. Es war eine andere Zeit. Achtung und Respekt vor der älteren Generation waren stärker ausgeprägt als heute. Die Familien lebten enger zusammen und hatten einen höheren Zusammenhalt.
Ich behaupte, dass Kontaktabbrüche in vielen Fällen vermeidbar wären. Wenn wir mehr miteinander reden würden und die Partnerwahl unserer Kinder akzeptieren. Wenn Schwiegerkinder ihre Schwiegereltern, insbesondere die Schwiegermutter, nicht zu einem Feindbild stilisieren. Und wenn wir uns wieder auf die alten Werte mit den Namen Respekt und Achtung besinnen.
Kontaktabbrüche in der Familie tun weh. Auch wenn viele damit leben, weil sie glauben, dass sie es doch nicht ändern können. Oder weil sie es nicht ändern wollen. Wir haben nur eine Mutter und einen Vater. Ihnen haben wir unser Leben zu verdanken. Was nicht heißt, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Doch leichtfertig sollten wir den Kontakt nicht einstellen. Wir könnten es eines Tages bitter bereuen.

© Jette G. Schroeder