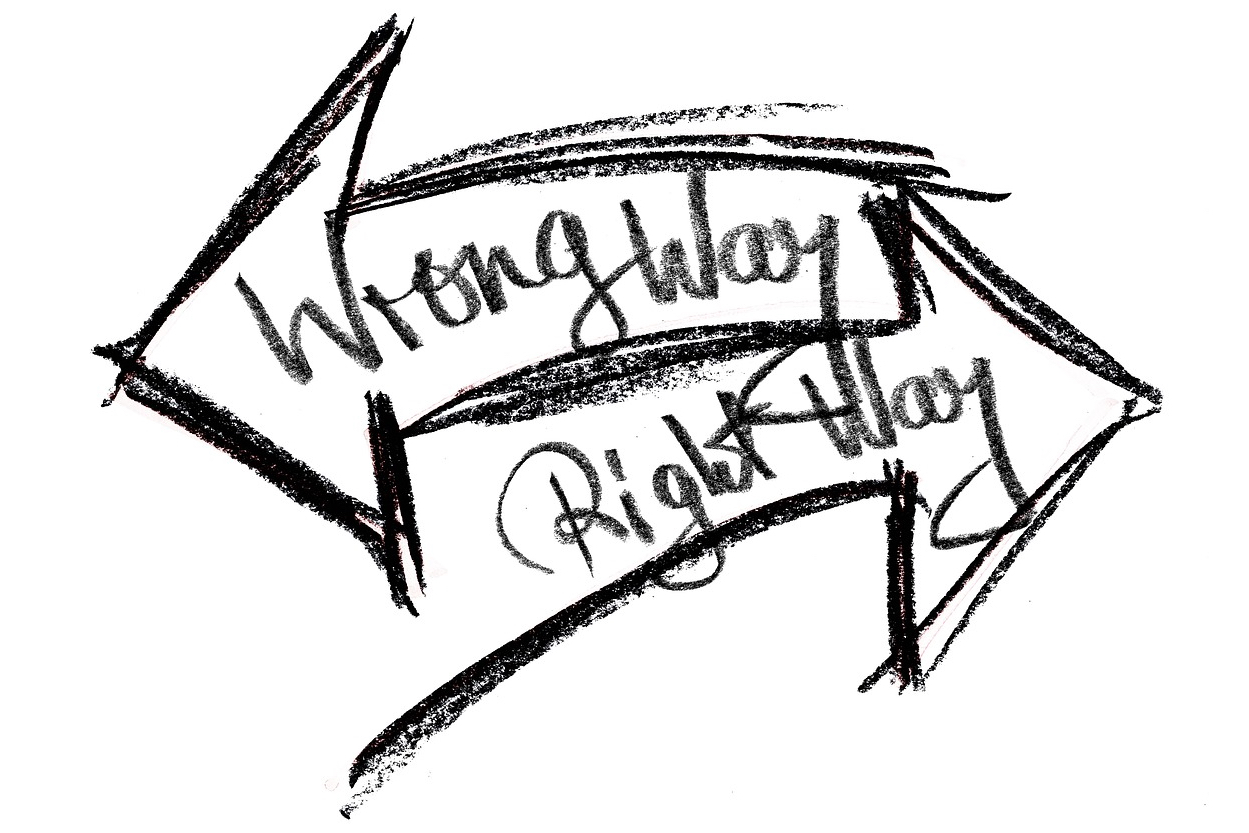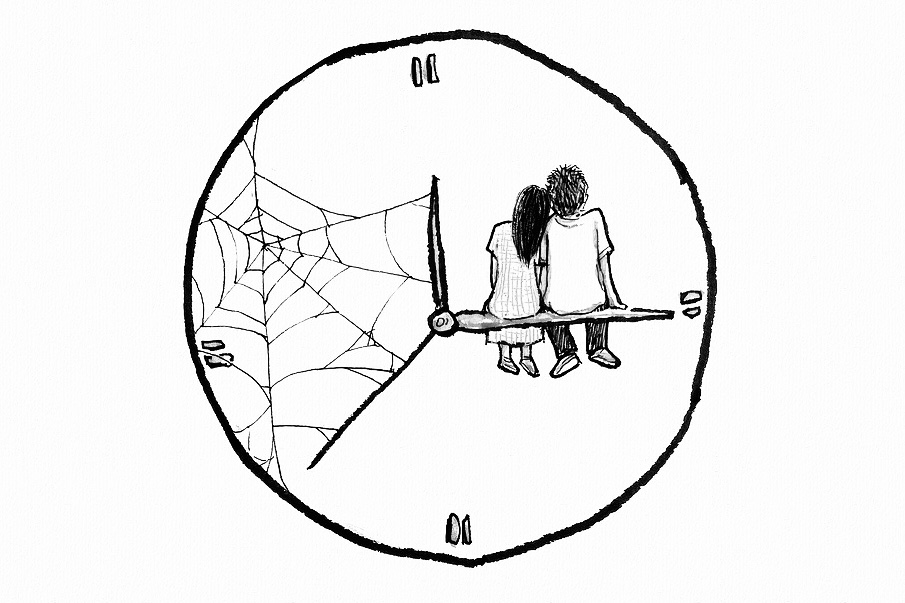Aufgewachsen in der DDR: Von der Krippe zum Abitur
Aufgewachsen in der DDR: Ja, es gestaltete sich ein bisschen anders als bei unserem Nachwuchs, den wir in der Bundesrepublik großziehen. Über unsere Zeit zwischen Kinderkrippe und Abitur wird viel geschrieben. Leider haben die Autoren oftmals selbst keine Kindheit in der DDR erlebt. Mit der Recherche nehmen sie es nicht so genau. Einen dieser halbherzigen Artikel möchte ich gern richtigstellen. Warum mache ich das? Weil ich es kann, würde mein Sohn jetzt sagen. Ich finde diesen Spruch ein bisschen frech und mildere ihn einmal ab: Ich bin in der DDR zur Schule gegangen und teile meine Erinnerungen mit dir.

Unsere Schulzeit im Netz: Voll von Missverständnissen
Zum Thema Kindergarten und Schule bin ich im Netz über einen Artikel aus dem Jahre 2020 gestolpert. Friederike hat ihn auf der Seite Kindersache.de veröffentlicht. Das Bild der Autorin ist so winzig, dass es nicht genau auszumachen ist, ob sie ein Kind der DDR gewesen sein könnte. Für weitere Informationen ist eine Anmeldung erforderlich. Ich stelle kühn die Behauptung auf, dass Friederike von unserer Kindheit und Jugend wenig Ahnung hat. Sie ist augenscheinlich zu jung und die Informationen, die sie dem Leser gibt, sind in vielen Formulierungen falsch bis ungenau.
Wenn ich derartige Artikel lese, stelle ich mir die Frage, warum wir, die wir diese Zeit erlebt haben, nicht aus erster Hand darüber berichten dürfen. Autoren mit westdeutscher Biografie schreiben Artikel in Zeitungen oder veröffentlichen sie digital. Sie stürzen sich auf Informationen aus dem Netz und aus der Literatur. Das können sie doch in 50 Jahren machen, wenn wir nicht mehr da sind. Noch ist es möglich, uns zu fragen. Wir antworten gern. Nur haben wir manchmal das Gefühl, dass unsere Antworten gar nicht gehört werden wollen. Sind sie zu positiv, für das Bild, welches nach der Wende von unserem Leben gezeichnet wurde? Aber nein, ich möchte jetzt nicht zu tief in diese Diskussion einsteigen. Ich nehme einfach mal Bezug auf den Artikel und lege los.
Kinderkrippe und Kindergarten in der DDR
Beginnen wir mit der Zeit nach der Geburt. In der DDR gab es für jedes Kind einen Platz in Krippe oder Kindergarten. Gebühren fielen nicht an. Komplett kostenlos war die Betreuung aber nicht: Unsere Eltern mussten Essengeld bezahlen. Die Kinderkrippe ging bis zum dritten Geburtstag, dann kamen wir in den Kindergarten. Dabei wechselten wir den Standort: eine Betreuung von null bis sechs Jahren, wie wir sie heute kennen, gab es nicht.
Im Artikel steht, dass wir mit vier Jahren in den Kindergarten kamen und dass unsere Mütter „kaum … ein bis zwei Jahre Mutterschaftsurlaub genommen haben“. Beides ist leider falsch.
In der DDR wurde Arbeit großgeschrieben. Damit Frauen genauso berufstätig sein konnten wie Männer, war es üblich, Babys bereits mit einem Jahr oder jünger in eine Kinderbetreuung (Krippe) zu geben.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/kindheit-der-ddr
Großgeschrieben wurde Arbeit in der DDR nicht unbedingt. Meine Eltern und Großeltern hatten so wie wir Tage, an denen sie keine Lust hatten oder ihre Arbeit verfluchten. Alles ganz normal. Richtig ist, dass die Arbeitskraft der Frauen in der DDR gebraucht wurde. Nach dem Krieg lief die Wirtschaft schleppender an als in der BRD: Dort gab es den Marshallplan, bei uns bauten die Sowjets Maschinen, Anlagen und Schienen für den Wiederaufbau in ihrem eigenen Land ab. Im Verlauf der Jahre entstanden neue Betriebe, in denen Frauen selbstverständlicher arbeiteten, als dies in der BRD der Fall war. Trotzdem gab es für Mütter die Möglichkeit, nach der Geburt ihres Babys zu Hause zu bleiben.
Es gab ein Babyjahr
Der Mutterschutz endete in der DDR sechs Wochen nach der Geburt. Danach konnten Mütter wieder arbeiten gehen und ihr Baby in die Kinderkrippe geben. Für einen Zeitraum von fünf Monaten bekamen sie eine bezahlte Babyzeit. Gezwungen wurde keine Mutter zur Arbeit. Jede Frau entschied das freiwillig. Die Beschäftigungsquote betrug 90 Prozent.
Autorin Friedrike schreibt vom Mutterschaftsurlaub: In der DDR hieß die bezahlte Elternzeit aber „Babyjahr“. Ab 1976 konnten sie Mütter ab dem zweiten Kind für zwölf Monate in Anspruch nehmen. Zehn Jahre später wurde sie auch für das erste Kind eingeführt.
Nicht jedes Kind besuchte eine Krippe
Mein Bruder und ich waren in keiner Krippe. Nach meiner Geburt blieb meine Mutter sieben Monate zu Hause. Dann arbeitete sie halbtags und ich wurde von meiner Omi betreut. Sie erkrankte schwer, als ich vier Jahre alt war. Erst da kam ich in den Kindergarten.
Mein Bruder war das zweite Kind: Meine Mutter nahm das bezahlte Babyjahr in Anspruch und blieb zwei weitere Jahre unbezahlt zu Hause. Diese Möglichkeit gab es in den 1970er-Jahren, ohne dass der Arbeitsplatz verloren ging. Nach drei Jahren stieg sie in Teilzeit wieder ein. Und war es keineswegs „üblich“, Babys in die Kinderkrippe zu geben. Mein Bruder und ich sind nicht die einzigen Kinder, die bei ihrer Oma blieben und eine in Teilzeit arbeitende Mutter hatten. Wir teilten dieses Privileg mit mehr als einem Viertel der DDR-Kinder, denn nur 73 Prozent der Frauen in der DDR arbeiteten in Vollzeit.
In einer Reihe auf dem Töpfchen sitzen
Meine beiden älteren Kinder haben ebenso wie mein Mann und ich eine Geburtsurkunde mit dem Emblem der DDR. Der Kindergarten war in Bezug auf den Topf kritikwürdig: Jedes Kind hatte einen, sie waren im Waschraum aufgereiht. Ab einem Alter von einem Jahr wurden die Kinder nicht mehr gewickelt. Sie sollten lernen, sauber zu werden. Ein nasses Höschen galt dabei als eine Erziehungsmethode, die heute zu Recht fragwürdig ist. Das hätte aber nicht dazu führen müssen, dass Kinder der heutigen Generation im Kindergartenalter noch Windeln tragen.
Die Woche in Krippe und Kindergarten war ebenso durchstrukturiert wie der Gang aufs Töpfchen: Es gab feste Essenszeiten, einen Mittagsschlaf, Basteln, Sport, Toben und Beschäftigung. In unserer städtischen Kita, die die Wende überdauerte, wurde dies in leicht gelockerter Form bis in die Nuller Jahre beibehalten. Unser jüngstes Kind wurde dann ein Opfer der freien Beschäftigung. Ich schreibe das ganz bewusst so, denn ich bin kein Freund der antiautoritären Erziehung. Aber ich muss es auch nicht mehr sein: Meine Kinder sind heute erwachsen und zeigen uns, dass wir nicht alles falsch gemacht haben. Doch ich wollte ja von meiner Kindheit und Jugend berichten.
Zehn Jahre gemeinsames Lernen
Mit sechs Jahren kamen wir in die Polytechnische Oberschule, abgekürzt POS. Unsere zehnjährige Pflichtschulzeit begann am ersten Montag im September. Mein Jahrgang wurde am 1. September eingeschult, das war ein Sonnabend. Am 3. September hatten wir unseren ersten Schultag. Dies hat Autorin Friederike fast richtig dargestellt. Dann hagelt es aber Fehler, die ich gern richtigstellen möchte.
Wir kannten weder eine Grundschule noch eine Oberschule. Von der ersten bis vierten Klasse gingen wir in die Unterstufe, von der fünften bis zehnten in die Oberstufe. In der Unterstufe wurden wir in Deutsch, Mathematik, Zeichnen, Musik, Sport und Heimatkunde unterrichtet. Zusätzlich gab es die Fächer Werken, Schulgarten und Nadelarbeit.
Ab der fünften Klasse lernten wir verpflichtend Russisch, ab der Siebten kam Englisch dazu. Dieser Unterricht war faktultativ, also freiwillig. Er fand in der nullten oder siebten Stunde statt. Biologie, Geschichte und Erdkunde bekamen wir ebenfalls in der fünften Klasse als neue Fächer. Deutsch wurde aufgespalten in Lesen, Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck. Meine Lieblingsfächer waren die Sprachen und Geschichte. Warum wohl? 🙂
Ab der sechsten Klasse lernten wir Physik, ab der siebten schloss sich der Kreis mit den restlichen Fächern. Hier hat sich Autorin Friederike einige Schnitzer erlaubt.
Staatsbürgerkunde: Politische Bildung made in DDR
Allerdings hatten die Schülerinnen und Schüler noch das Schulfach Staatsbürgerkunde. Dort lernten sie alles über die DDR und ihren politischen Werdegang.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/kindheit-der-ddr
Das Schulfach Staatsbürgerkunde – wir nannten es Staabi – bekamen wir gemeinsam mit der Chemie und dem Englischunterricht in der siebten Klasse. Es war nichts anderes als Politische Bildung. Natürlich lernten wir das System der DDR kennen, so wie die Schüler sich heute mit dem System der Bundesrepublik beschäftigen. Um den „politischen Werdegang der DDR“ ging es in dem Fach aber nicht.
Primär bekamen wir die Vorteile des Marxismus-Leninismus und die Nachteile des Kapitalismus aufzeigt. Ja, der Unterricht war richtungsweisend und der Kapitalismus war laut Merksatz faulend, stinkend und parasitär. Das ist sehr drastisch ausgedrückt, die BRD war schließlich unser Klassenfeind. Aber dennoch gibt es einige Züge in der kapitalistischen Marktwirtschaft, die dieser Umschreibung mehr oder weniger entsprechen, oder?
Eine kleine Anekdote aus unserem Staatsbürgerkunde soll aufzeigen, dass die Stasi nicht in jedem Raum eine Wanze versteckt hatte. Das war bei 200.000 Mitarbeitern, die 16 Millionen Bürger analog überwachten, auch gar nicht möglich.
Frau Lehmann, eine wundervolle Lehrerin, die Sport und Staatsbürgerkunde unterrichtete, stellte in der neunten Klasse die Frage, wer denn der Außenminister der DDR wäre. Unsere Klasse schwieg, es war mucksmäuschenstill. Nach einigen Sekunden stellte Frau Lehmann eine andere Frage: Wer ist denn der Außenminister der BRD? Im Chor riefen wir laut: Genscher! Dass unser Außenminister Fischer hieß, wussten wir nicht. Schließlich lebten wir nicht im Tal der Ahnungslosen und konnten Westfernsehen schauen.
Das Schulfach ESP: Von uns ging niemand in die Produktion
Der wohl größte Unterschied zum heutigen Unterricht sind aber vermutlich die Schulfächer „Einführung in die sozialistische Produktion (ESP)“ und „Unterrichtstag in der Produktion (UTP)“. Produktion bedeutet so viel wie die Herstellung und die Verarbeitung von Gegenständen. Beide Fächer wurden ab der 7. Klasse unterrichtet. Das Ziel vom theoretischen ESP war es, den Schülerinnen und Schülern den Zusammenhang zwischen Unterricht und Arbeitsleben beizubringen. Außerdem sollten möglichst früh neue Arbeitskräfte für die Produktion gewonnen werden.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/kindheit-der-ddr
Ich habe meine eigene Schulzeit in der DDR erlebt und die Schulzeit meiner Kinder in der Bundesrepublik begleitet. Deshalb möchte ich der Autorin Friederike gern sagen, dass meine Kinder im westdeutschen Schulsystem sehr wohl im Schulfach ESP unterrichtet wurden.
ESP war tatsächlich die „Einführung in die sozialistische Produktion“. Unsere Kinder hatten ähnliche, auf die moderne Marktwirtschaft zugeschnittene Inhalte im Fach Arbeitslehre. Bei unseren jüngeren Kindern hieß das Fach dann „Wirtschaft-Arbeit-Technik“. Wir hatten zusätzlich noch die Fächer Werken bis Klasse Zehn und Technisches Zeichnen in den Klassen Sieben und Acht. All dies wird im heutigen Schulsystem in Arbeitslehre/WAT zusammengefasst.
Dass der Begriff Produktion die „Herstellung von Gegenständen“ bedeutet, ist eine interessante Information, die sich bis heute nicht geändert hat. Im ESP-Unterricht wurde aber keineswegs ein „Zusammenhang zwischen Unterricht und Arbeitsleben“ vermittelt. Wir lernten, ebenso wie in der Arbeitslehre heute, wie die Wirtschaft funktioniert. Damals war es Planwirtschaft in genossenschaftlichen und staatseigenen Betrieben, heute ist es Marktwirtschaft.
Wir hatten freie Berufswahl
Unsere Berufe suchten wir uns im Übrigen selbst aus. Ich weiß nicht, woher das Klischee stammt, dass wir alle „auf die Arbeit in der Produktion“ vorbereitet werden sollten. Autorin Franziska ist nicht die Einzige, die es bedient. In unserer Region gab es kaum Produktionsbetriebe, wir wären arbeitslos gewesen. Somit hat niemand aus meiner Klasse einen Beruf in der Produktion gelernt: Wir wurden Krankenschwester, Zahntechniker, Kellner, Koch, Gärtner, Fischer, Facharbeiter für Schreibtechnik, BSMR-Techniker, Werkzeugmacher, Schlosser. Aufs Gendern verzichte ich bewusst, das gab es in den 1980er- Jahren weder in der DDR noch in der BRD.
UTP hieß PA und war ein Praktikum
Etwa alle zwei Wochen gab es dann einen UTP. Alle Schülerinnen und Schüler mussten für einen ganzen Tag im Partnerbetrieb der Schule in der Produktion arbeiten. Meistens arbeiteten sie in der Landwirtschaft, der Industrie oder im Bauwesen.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/kindheit-der-ddr
Zunächst einmal: UTP ist die alte Bezeichnung für den „Unterrichtstag in der Produktion“, die aus der Generation meiner Eltern stammt. Sie gingen in den 1950er-Jahren in die Schule. Unsere Einschulung folgte 20 Jahre später. Das Unterrichtsfach hieß „Produktive Arbeit“. Abgekürzt PA. Wir belegten es zwischen der siebten und der zehnten Klasse.
Wieder taucht im Zitat von Autorin Friederike das Wort „Produktion“ auf. Ja, wir arbeiteten in der Produktion. Aber nicht ausschließlich und schon gar nicht den ganzen Tag. PA war nichts anderes als das Praktikum heute, welches alle Schüler in der neunten und zehnten Klasse absolvieren.
Bei uns in Brandenburg dauert das Praktikum in der neunten Klasse zwei und in der zehnten drei Wochen. Die Arbeitszeit betrug sieben Stunden täglich. PA fand vierzehntätig statt. Wir arbeiteten vier Stunden und hatten mittags Schluss. Allein deshalb fanden wir das Fach „urst schau“, um mal in meinem Dialekt zu sprechen.
Ob unser PA länger dauerte als das Praktikum der Schüler heute, habe ich nicht ausgerechnet. Bei uns wechselte der Betrieb in jedem Halbjahr. Ich habe Zündkerzen zusammengeschraubt oder Büroarbeit erledigt. Nix Produktion. Spaß hat es gemacht, es war eine Abwechslung vom Schulunterricht. Ich war Streber und hatte immer eine Eins.
Nach der zehnten Klasse war unsere gemeinsame Schulzeit beendet. Wir begannen eine Berufsausbildung, die anderthalb bis drei Jahre dauerte. Den Weg bis zum Abi gab es in der DDR natürlich auch.
Das Abitur in der DDR
Das Abitur legten wir in der DDR in der elften und zwölften Klasse ab. Dazu wechselten wir von der POS auf die EOS. Das ist die Abkürzung für die „Erweiterte Oberschule“. Es stimmt, dass wir nicht so einfach selbst entscheiden durften, ob wir zum Abi gehen wollen. Aus unserer Klasse hat nur eine Mitschülerin ihr Abitur abgelegt. Sie wechselte nach der achten Klasse auf die EOS. Aber alles war ganz anders, als es Autorin Franziska beschreibt.
Die Aufnahme in die EOS erfolgte bis 1981 nach der 8. Klasse, dann nach der 10. Klasse. Allerdings waren die Abiturplätze in der DDR begrenzt. Zehn Prozent eines Jahrgangs, also nur die Besten, durften weitermachen. In manchen Jahren war es sogar so extrem, dass nur der beste Junge und das beste Mädchen einer Klasse Abitur machen durften.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/kindheit-der-ddr
Die Quellen dieser Aussage würde ich gern einmal sehen. Es stimmt, dass der Wechsel in die EOS bis 1981 nach der achten Klasse erfolgte. Aber auch später war es noch möglich: Ich bin jünger, doch das Mädchen, das aus meiner Klasse Abi machte, wechselte nach der achten Klasse auf die EOS. Auch nach 1981 war das für hochbegabte Schüler möglich.
Wir entschieden uns für eine Berufsausbildung
Wir waren eine sehr leistungsstarke Klasse: Vier von uns schlossen die zehnte Klasse mit einem Notendurchschnitt von 1.0 ab. Niemand hatte einen Durchschnitt schlechter als drei. Dennoch wechselte keiner auf die EOS.
Die leistungsstarken Schüler entschieden sich für eine Berufsausbildung mit Abitur. Ich gehörte zu den Besseren, wollte aber Krankenschwester werden. Dafür reichte die zehnte Klasse. Doch ich wurde nicht zum Abitur vorgeschlagen, da mein Vater Akademiker war. Nicht der beste Junge und das beste Mädchen kamen vorrangig auf die EOS, sondern Kinder aus Arbeiterfamilien wurden bevorzugt.
Aus meiner Schulzeit kenne ich nur ein Mädchen, dem das Abitur verweigert wurde. Es war die Tochter des Pfarrers. Staat und Kirche hatten in der DDR ein sehr ambivalentes Verhältnis zueinander. Da gab es tatsächlich Benachteiligungen.
Auch heute kommt nicht jeder aufs Gymnasium
Grundsätzlich durften wir mitentscheiden, wie unser Weg nach der Schule verlaufen sollte. Richtig ist, dass nicht jeder für das Abitur infrage kam. Sei es aus staatlichen oder persönlichen Gründen. Heute ist das aber nicht so anders: Brandenburg wird seit der Wende von der SPD regiert. Es gibt mehr Gesamtschulen als Gymnasien. Hier entscheiden nicht die Eltern, sondern die Notenpunkte für die Aufnahme. Und schon sind wir wieder bei den Besten der Klasse! Wer Geld an den Förderverein spendet, hat Vorteile. Das ist eine Information aus der Schulzeit meiner Kinder, die mittlerweile erwachsen sind. Wie das heute gehandhabt wird, kann ich nicht sagen.
Nach der Berufsausbildung gab es die Erwachsenenqualifizierung
Alle anderen hatten dann nur die Möglichkeit nach der 10. Klasse eine Berufsausbildung zu machen.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/kindheit-der-ddr
Auch das ist ein Satz, den ich so nicht stehenlassen möchte. Wer kein Abitur machte, entschied sich für eine Berufsausbildung, das ist richtig. Gap Year, Sabattical und andere Formen der Auszeit kannten wir nicht. Doch mit der Berufsausbildung war unser Weg nicht zu Ende.
In der Erwachsenenqualifizierung konnten wir einen zweiten Beruf lernen oder das Abitur nachholen. Außerdem gab es die Möglichkeit eines auf dem Beruf aufbauenden Studiums ohne Abitur mit dem Abschluss des Ingenieurs. Diesen Weg gibt es in der BRD nicht. Die Qualifizierung wurden nach der Wende in der Regel anerkannt, wenn eine dreijährige Vollzeit-Berufstätigkeit nachgewiesen werden konnte.
Das Studium in der DDR
Das Studium dauerte in der DDR einheitliche fünf Jahre. Es war sehr verschult: Seminare und Vorlesungen waren fest vorgeschrieben. Jungen meiner Generation mussten vor dem Antritt des Studiums drei Jahre zur Armee gehen. In der Generation meiner Eltern waren es zwei Jahre. Es war eine Art freiwilliger Zwang: Wer nur den anderthalbjährigen Grundwehrdienst ableistete, bekam keine Sicherheit für einen Studienplatz.
Die Jungen Pioniere
Abschließend möchte ich noch von unseren Jugenorganisationen erzählen. Die Informationen der Autorin Friederike sind falsch.
Die Jungen Pioniere waren eine politische Organisation für Kinder ab der 1. oder 2. Klasse. Die Uniform, die von den Mitgliedern zu besonderen Anlässen getragen werden musste, bestand aus einer weißen Bluse und einem blauen Halstuch, sowie einer blauen Hose oder einem blauen Rock.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/kindheit-der-ddr
Wir wurden am 13. Dezember der ersten Klasse in die Pionierorganisation „Ernst Thälmann“ aufgenommen. Das war der Pioniergeburtstag. Der Festakt fand für uns in Potsdam statt. Wir bekamen ein blaues Halstuch und durften uns „Jungpioniere“ nennen. Wir fanden das toll.
Zu den Pioniernachmittagen trugen wir das Halstuch, zum Fahnenappell die weiße Pionierbluse. Nur diese beiden Teile waren verpflichtend! Hose, Rock und Käppi konnten unsere Eltern kaufen, mussten sie aber nicht. Ich habe das nie besessen und es war nie ein Problem.
Rotes Halstuch ab Klasse Vier
Autorin Franziska vergaß zu erwähnen, dass wir ab der vierten Klasse das Halstuch gewechselt haben. Wieder war es der Pioniergeburtstag am 13. Dezember: Wir wurden feierlich zu Thälmannpionieren und bekamen ein rotes Halstuch überreicht. Nun waren wir die Großen, die sich um die Kleinen in verschiedenen Patenschaften kümmerten. Geschadet hat es uns nicht.
Ausgrenzung unter den Klassenkameraden gab es nicht!
Obwohl es nicht verpflichtend war, bei den Jungen Pionieren zu sein,wurden so die Kinder ausgegrenzt, die keine Mitglieder der Organisation waren. Sie durften nicht an den Freizeitaktivitäten teilnehmen und verloren so den Anschluss zu ihren Klassenkameraden.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/kindheit-der-ddr
Diese Aussage ist so falsch, dass sie mich sauer macht. Wir gingen in festen Klassenkollektiven zur Schule und grenzten niemanden aus. Die Tochter des Pfarrers war nicht bei den Pionieren, nicht bei der FDJ und sie bekam keine Jugendweihe. Dennoch war sie in ihrer Klasse ungemein beliebt und sie nahm an allen Freizeitaktivitäten teil.
Ausgeschlossen waren die Schüler lediglich von den Pioniernachmittagen und den FDJ-Nachmittagen. Diese fanden während der Schulzeit jeden Mittwoch statt. Dabei handelte es sich aber um eine von vielen Freizeitaktivitäten, die wir gemeinsam planten. Für mich ist dieser Satz der Beweis, dass Autorin Franziska von unserem Leben in der DDR leider überhaupt keine Ahnung hat. Ich würde gern einmal wissen, warum sie nicht wenigstens sorgfältig recherchiert hat.
Die Freie Deutsche Jugend
Mit 14 folgte dann ein weiterer Meilenstein im Leben der Kinder: Die Jugendweihe. Endlich wurden sie zu Jugendlichen und mussten zum Beispiel von den Lehrern mit “Sie” angesprochen werden. Nach der Jugendweihe konnte man Mitglied der Freien Deutschen Jugend (FDJ) werden.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/kindheit-der-ddr
Ich liefere gern die exakte Reihenfolge: Mit dem Beginn der siebten Klasse bereiteten wir uns im „Zirkel unter der blauen Fahne“ auf die Aufnahme in die FDJ vor. Er dauerte ein halbes Jahr und wurde von zwei Schülerinnen der neunten Klasse geleitet. Er fand Mittwochs anstelle der Pioniernachmittage statt. Im Frühling erfolgte die Aufnahme in die FDJ. Da waren die meisten Schüler unserer Klasse noch 13 Jahre alt.
Die Jugendweihe
Die Jugendweihe fand in der achten Klasse statt. Die Termine lagen auf einem Sonnabend im April oder Mai. Wir hatten unsere Jugendweihe am 14. April. Mit dem Eintritt in die FDJ hatte die Jugendweihe nichts zu tun, das war ein Jahr zuvor erledigt worden.
Die Lehrer sollten uns mit „Sie“ ansprechen, das stimmt wohl. Unser Deutschlehrer meinte „ich denke gar nicht daran“. Nur wenige haben das wirklich umgesetzt und uns war es sehr unangenehm. Wenn wir nach der Jugendweihe gefragt wurden, haben wir uns immer für das „du“ entschieden.
Wir hatten eine glückliche Kindheit
Unsere Kindheit beschreibt Autorin Franziska in ihrem Artikel abschließend mit diesen Worten:
Generell war die Kindheit in der DDR sehr von den gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Jugendorganisationen geprägt. Trotzdem wurde viel Wert auf Bildung und Arbeit gelegt und alle Kinder sollten so ausgebildet werden, dass sie den Staat später unterstützen konnten. Alles war sehr geregelt und klar bestimmt. Der wohl größte Unterschied zu heute ist aber, dass sich heute alle Kinder unabhängig von der politischen Einstellung ihrer Eltern entwickeln können. Das war damals ganz anders. Kindern von Regierungskritikerinnen und -kritikern(das sind Menschen, die etwas an der politischen Situation auszusetzen haben und das Vorgehen der Regierung in Frage stellen) wurden oft Steine in den Weg gelegt. Ihnen wurde die Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft genommen.
Quelle: https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/politik/kindheit-der-ddr
Unsere Kindheit war nicht von den Aktivitäten in den Jugendorganisationen geprägt. Und schon gar nicht von irgendwelcher Arbeit. Das war in der DDR bis zum 14. Lebensjahr verboten. Es gab bei uns keine Kinder, die für ganz schmales Geld am Wochenende kostenlose Zeitungen in die Briefkästen stecken mussten.
Ich weiß nicht, ob ich für alle Schüler in der DDR sprechen kann, aber wir hatten einmal im Monat einen Pioniernachmittag. Ab der siebten Klasse waren es die Zusammenkünfte der FDJ. Da haben wir nicht nur über den Sozialismus gesprochen, sondern Klassendisco mit Modern Talking und Neuer Deutscher Welle gefeiert. Wir sind zusammen zur Tanzschule gegangen, haben mit unserem Lehrer Potsdam unsicher gemacht und Theaterstücke aufgeführt.
Das Ding mit der politischen Beeinflussung
Gern wird von der politischen Beeinflussung gesprochen, aber an mir ist die wohl vorbeigegangen. Ich mochte die Grenze nicht und habe die Wende gemeinsam mit meinem Mann und schwanger mit meinem zweiten Kind euphorisch gefeiert. Wir sind gleich alt, in unterschiedlichen Bezirken aufgewachsen, und haben dennoch viele ähnliche Erlebnisse gehabt. Gemein sind uns die Erinnerungen an eine schöne Kindheit. Und die wollen wir uns nicht nehmen lassen.
Die Tochter des Pfarrers hatte nach der Schule eine Ausbildung absolviert. Nach der Wende hat sie das Abitur nachgeholt und studiert. Es mag stimmen, dass Kinder von Regimekritikern ausgegrenzt wurden. Doch das waren Ausnahmen, die heute sehr intensiv thematisiert werden. Ja, die DDR war eine politisch motivierte Diktatur. Sie war ein Satellitenstaat der Sowjetunion. Wir waren in unserer Freiheit eingeschränkt, hatten keinen so hohen Lebensstandard wie in der BRD und eine schlechtere Versorgung. Dennoch habe ich, aufgewachsen in einer Kleinstadt am Rande Berlins und damit am Rande der Mauer, nicht ein einziges Mal die Härte der Stasi zu spüren bekommen. Meine Familie, meine Freunde und mein Umfeld auch nicht.
Unser kleines Leben
Ich bleibe dabei: Wir hatten eine glückliche Kindheit. Das spreche ich offen aus und das lasse ich so stehen. Es gab die politische DDR. Aber unser kleines Leben, in der Familie, mit den Freunden und in der Schule, das war unbeschwert. Ob ich als Erwachsene in der DDR glücklich geblieben wäre, kann ich nicht sagen. Über Ungarn zu fliehen, war für uns kein Thema.
Ja, es hat mich gestört, dass ich keine so tollen Klamotten wie meine Cousinen aus Münster hatte, dass ich meinen Onkel in Hamburg nicht besuchen und nicht, wie er, nach Mallorca fliegen durfte. Mit jedem Lebensjahr mehr. Aber bevor wir als junge Erwachsene darüber nachdenken konnten, ob wir in der DDR bleiben wollen, fiel die Mauer.
Nun leben wir mehr als drei Jahrzehnte im Westen. Dürfen wir denn heute die Arbeit der Regierung in Frage stellen, liebe Autorin Franziska? Du hast den Artikel über unsere Kindheit in der Coronazeit geschrieben.
Ich lasse diese Frage so stehen und hoffe, dass ich dir, lieber Leser, liebe Leserin, einen positiven Eindruck von unserem Aufwachsen in der DDR vermitteln konnte. Es war nicht alles gut, das steht außer Frage. Doch es war auch nicht alles schlecht. Ein Song von der Ostband „Die Prinzen“, die ich sehr verehre.
Andere Erfahrungen?
Mir ist bewusst, dass es viele Menschen gibt, die andere Erfahrungen gemacht haben. Was mich stört. ist, dass das Negative so geballt in den Vordergrund gerückt wird. Die Serie „Weissensee“ ist ein Beispiel: Ich mag sie, habe sie etliche Male geschaut, die Schauspieler sind genial. Aber alles, was möglich war, wird einer Familie zugeschrieben. Das ist künstlerische Freiheit. Aber wer die DDR nicht kannte, denkt, dass es überall so war. Und das stimmt nicht.
Über andere Erfahrungen können wir uns gern austauschen. Der Artikel ist nicht in Stein gemeißelt und kann jederzeit ergänzt werden.
Übrigens: „Kinderseite.de“ ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft vernetzter Kinderseiten. Sie wurde vom MDR mit dem Runkfunkrat-Kindermedienpreis ausgezeichnet. Es ist sehr traurig, dass auf einer renommierte Seite Artikel mit so schlecht recherchierten Informationen veröffentlicht sind.

© Jette G. Schroeder